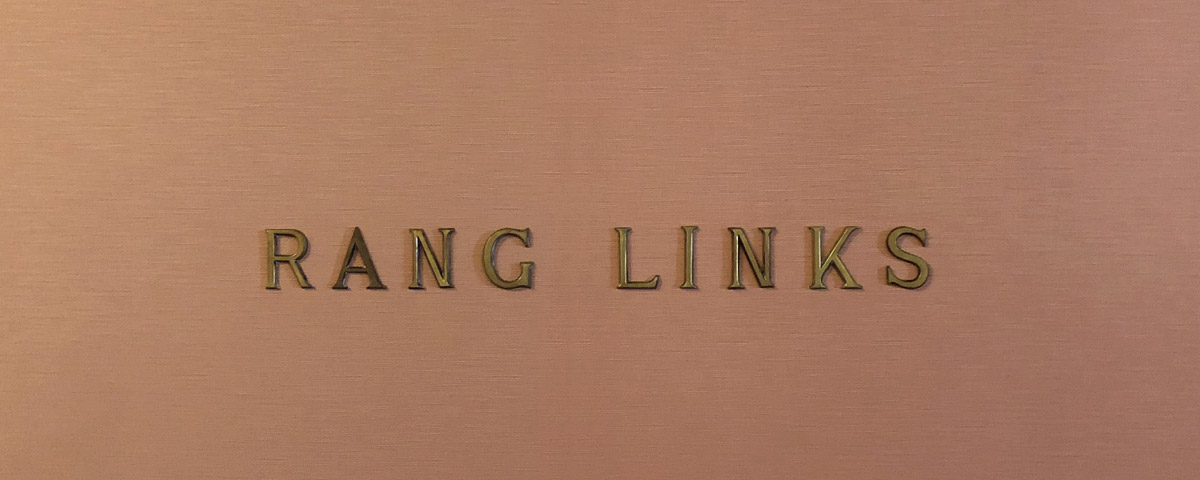
Großes Festspielhaus, Salzburg (Detail).
© Thomas Prochazka
Asmik Grigorian als Lady Macbeth bei den Salzburger Festspielen
Von Thomas Prochazka
Für Erzeugnisse gleicher Art leisten sich Online- und Printmedien sogenannte » Großkritiker «. Diese suchen in ihren wöchentlich erscheinenden Beiträgen feuilletonistisch in einem Satz pro Sänger zu dekretieren, was die geneigten Leser und Besucher von den besprochenen Ereignissen zu halten haben. Mit einem Bemühen um die Sache hat das zwar wenig gemein, doch gilt ein vermeintlich geglückter Aphorismus manchmal mehr als tiefergehende Betrachtung.
Die unterschiedlichen Reaktionen auf die Macbeth-Produktion machten denn auch den seit Wochen Opernabstinenten neugierig. Im folgenden daher Eindrücke zu Asmik Grigorians Rollen-Debut als Lady Macbeth, gewonnen als » Vidop « — als video opera, dem Live-Mitschnitt der Première vom 29. Juli 2023.
II.
Dies bedeutet einmal mehr die Beschäftigung mit der klassischen Gesangstechnik; und zwar den fundamentalen Dingen, nicht den schönen Schnörkeln. Das als etwas abzutun, das nur Professionisten betrifft, halte ich für falsch. Denn es sind diese Dinge, welche nicht nur den Klang und das Verhalten einer Stimme ausmachen, sondern deren interpretativen Rahmen abstecken und damit unmittelbaren Einfluß auf unser Empfinden und unsere emotionalen Eindrücke einer Aufführung ausüben. Jeder, der daran interessiert ist, sollte auch an jenen Dingen interessiert sein, welche unsere Eindrücke bestimmen: das Handwerk, das für die Hervorbringung dieser Kunst vonnöten ist.
III.
Franz Welser-Möst legte das Dirigat der Macbeth-Produktion Anfang Juli aus gesundheitlichen Gründen zurück. Mit Philippe Jordan wurde der Musikdirektor der Wiener Staatsoper als Ersatz gefunden. Jordan, so hörte man, akzeptierte unter der Bedingung der Aufführung derselben Fassung wie im Frühjahr 2022 im Haus am Ring. Da Prinzipien eigentlich nicht verhandelbar sind, darf man davon ausgehen, daß Jordans vor knapp einem Jahr im Interview mit dem Kurier getätigten Aussagen betreffend die Vorherrschaft der Regie auf unseren Opernbühnen so ernst nicht gemeint war.
IV.
Szenisch hält dieser Abend, was der Besetzungszettel verspricht: Krzyzstof Warlikowski stülpte Verdis Oper in der revidierten Fassung von 1865 auf das Libretto von Francesco Maria Piave und den Ergänzungen Andrea Maffeis eine andere Geschichte über, verlegte die Handlung in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Schon bei Richard Strauss’ Elektra interessierten ihn Originalschauplatz und -zeit nicht. Małgorzata Szczęśniak schuf einen, glaubt man den von den Festspielen gestreuten Informationen, Anleihen am Jeu de paume in Paris nehmenden Einheitsraum mit nur wenigen Versatzstücken. (Soviel zu Philippe Jordans seinerzeit geäußerten Ansicht, das Publikum habe eine richtige Sehnsucht, einfach wieder einmal gutes Theater zu sehen und nicht nur irgendeine Fassung von Irgendjemandem über Irgendwas
.)
Die Unsitte, die Sängerin der Lady Macbeth den Brief ihres Gemahls nicht mehr selbst vortragen zu lassen, scheint sich epidemisch auszubreiten. Daß Verdi, Theaterpraktiker schon in jungen Jahren, seiner prima donna mit dem Lesen die Bühne bieten und vor ihrer ersten großen Szene die Möglichkeit einräumen wollte, das Publikum auf sich zu fokussieren, es zu fesseln, in den Abend hineinzufinden, ehe das durchaus anspruchsvolle Rezitativ (mit einer Koloratur bis zum hohen Sopran-›c‹ und wieder hinunter bis zum mittleren ›a‹) sowie die an technischen Anforderungen nicht armen Cavatina und Cabaletta folgen, scheint weder die Spielvogte noch die Dirigenten zu interessieren.
Es ist sinnlos, all den in dem Live-Mitschnitt beobachteten Widersprüchen in Warlikowskis Macbeth-Phantasie zwischen gesungenem Wort und dargestellter Handlung nachzuspüren: Es sind derer zuviele.
Weder kümmert es den Intendanten Markus Hinterhäuser noch seine, vom Gesetz her ihm vorgesetzte Präsidentin Kristina Hammer noch Dirigent Philippe Jordan, daß damit kulturelle (oder, besser, a-kulturelle) Aneignung des Verdischen Werkes betrieben wird: Denn alles, was ist, tritt an die Stelle dessen, was sein sollte. Wieder obsiegt das Argument, man müsse eine Oper aktualisieren, um sie für heutige Verhältnisse erfahrbar zu machen, über die eigentliche, allerdings weit schwierigere Aufgabe, aus Verdis und Piaves Werk das herauszuschälen, was für uns Heutige Relevanz besitzt.
Die Erklärung, Originalzeit und -ort seien uninteressant, halte ich für jene Schutzbehauptung, die sie ist: Nämlich, daß es am Können mangelt, das Werk in einer der Psyche der Personen nachspürenden Inszenierung und jene Zeiten und Gebräuche beobachtenden Personenführung zu erzählen; den Sängern Raum und Rahmen für das durch ihren Gesang gestaltete Drama zu geben: Oper ist Theater durch Gesang.
(Conrad L. Osborne)
V.
Die musikalische Seite des Abends brachte Asmik Grigorians Rollen-Debut als Lady Macbeth und, nach der Leitung der Premièren-Serie an der Wiener Staatsoper im Mai 2022, das Wiedersehen mit Philippe Jordan am Pult.
Jordans Dirigat war uneinheitlich: oft zu schnell, dann, im Finale des ersten Aktes, wieder schleppend. Immer allerdings, auch dies ein Zeichen unserer Zeit nicht nur in der Oper, sondern auch im Konzert, den Extremen zuneigend. Jeder Akzent wurde mit Bedeutung aufgeladen, wo einfaches » sich Anlehnen « an den Akkord nach alter Kapellmeisterart die intendierte Wirkung erzielte.
Das war bereits im Vorspiel nicht zu überhören, dessen Tempovorgabe Adagio (♩= 60) Jordan ebenso ignorierte wie die geforderten Dynamikangaben: Zwischen pianissimo und fortissimo hörte man kaum einen Unterschied. Daß Verdi an den leisen Stellen zusätzlich noch dolcissimo notierte, störte weder den großen Geist am Pult noch die ihm geistesverwandten Jubler in den Redaktionsstuben. Darüber hinaus wechselte Jordan das Tempo (freilich ohne jede Referenz in der Partitur) scheinbar nach Belieben. Da bieten die Interpretationen von Berthold Goldschmidt (Glyndebourne, 1947), Victor de Sabbata (Scala, 1952), Thomas Beecham (Ausschnitte, 1948) oder Claudio Abbado (Scala, 1975) viel mehr Details; klingen homogener, stimmiger und, abgesehen von den gesanglichen Leistungen, interessanter. (Das bedeutet nun nicht, daß es nicht z.B. beim Live-Mitschnitt aus dem Teatro alla Scala vom 7. Dezember 1952 manchmal rund ging, so manche Unsicherheit zwischen Chor und Orchester anzumerken wäre. Doch de Sabbatas Leitung führte zu einem runderen, harmonischeren Klang.)
Nun, in Salzburg, wartete Jordan des öfteren mit dem Beginn der nächsten Nummer, damit auf der Bühne noch eine Aktion abgeschlossen werden konnte. Vorbei sind die Tage, in welchen in der Oper der Musik das Primat der Zeit zufiel.
VI.
Verdi beginnt die Handlung — nach guter italienischer Operntradition fällt sie dem Chor zu — pianissimo; nicht nur in der gedruckten Partitur, sondern auch in jener handschriftlichen, aus der Aldophe Deloffre im April 1865 die Erstaufführung der revidierten Fassung an der Pariser Opéra dirigierte. Bei Philippe Jordan klingt alles nach mezzoforte: Er vergibt so alles Geheimnisvolle der kommenden Szene. Nach raschen Lautstärkewechseln ins fortissimo, unterbrochen von piano notierten Passagen, endet das instrumentale Vorspiel pianissimo.
Der Chor der Hexen (Che faceste? Dite su!
) hätte piano anzuheben und dieses auch beim nachfolgenden, staccato notierten Choreinsatz M’e fulata nel pensier
beizubehalten. Jordan läßt forte und mit Akzent spielen … — Agogik und Tradition hin oder her: Was ich bislang hörte, war eine Annäherung an Verdis Komposition; ein » Ungefähr «, doch stark von den Tempo- und Lautstärkevorstellungen des Schöpfers abweichend.
VII.
Exkurs: In einem Video-Beitrag, unmittelbar nach der Première noch im Großen Festspielhaus aufgenommen, verglich Markus Thiel, Musikredakteur beim Münchner Merkur, den Aufstieg Anna Netrebkos mit jenem von Asmik Grigorian. Zwar merkte er Grigorians Textundeutlichkeit an, folgerte allerdings nicht, daß eine fortgesetzte unsaubere Artikulation immer Ursache stimmtechnischer Mängel ist. Im Gegenteil, Thiel maß Grigorian den Status einer » Diva « zu.
In der Tat eignen den beiden Gemeinsamkeiten: Beide sind, so legen es frühe Zeugnisse ihrer Profession nahe, lyrische Soprane. Für beide begann der internationale Aufstieg nach Erfolgen bei den Salzburger Festspielen.
Der Unterschied zwischen beiden liegt darin, daß Anna Netrebko, als sie 1998 zum ersten Mal bei den Salzburger Festspielen auftrat (als Blumenmädchen in Parsifal in drei konzertanten Vorstellungen unter Waleri Gergiew), am Kirov (heute: Mariinski-Theater) sowie auf Gastspielen in San Francisco bereits einige Bekanntheit erlangt hatte. In der 1995 entstandenen Aufnahme von Michail Glinka’s Ruslan und Ludmila hören wir sie mit intaktem, lediglich in den Koloraturen ein wenig unsauberen Sopran. Der Ton ist rund, Linien und Attacke sind gut, Stimmsitz und Tongebung (man beachte die vertikale Mundstellung!) für heutige Verhältnisse geradezu vorbildlich. Allerdings war bereits damals ein eher zögerlicher Einsatz des Brustregisters nicht zu überhören. Selbst in diesem (frühen) Stadium ihrer Karriere dunkelte Netrebko die Vokale über dem passaggio ab, ehe die Stimme in der Höhe an Gewicht verlor, frei wurde. (Zum Vergleich höre man sich Vera Firsova als Ludmila an: Firsovas Stimme, wiewohl die eines Koloratursoprans und — bei derselben Tonhöhe — heller klingend als Netrebkos, erscheint uns lebendiger, spritziger, besitzt mehr Schärfe und Elastizität in der Linienführung.)
Danach folgten in Salzburg Donna Anna (mit Nikolaus Harnoncourt, 2002 und 2003), Natascha Rostowa und Bellinis Giulietta (2004), Violetta (2005) und Susanna (2006) — alles Partien des lyrischen Sopranfaches. Ab dem Sommer 2012 begann mit der Mimì und der Titelpartie in Verdis Giovanna d’Arco der Wechsel in das Spintofach. Damit einher ging, den Lockungen unwissender oder gewissenloser Agenten und Intendanten nachgebend, die stetige Überforderung eines einstmals, für unsere Tage ausgezeichnet disponierten lyrischen Instruments. Die Folgen sind heute für jeden, der sich der Wahrheit nicht verleugnet, nicht zu überhören.
VIII.
Der » Fall « Asmik Grigorian liegt anders. Auch sie scheint — soweit das heute noch zu identifizieren ist — ihrer » natürlichen « Stimme nach ein lyrischer Sopran zu sein. Grigorians Salzburger Karriere begann 2017 als Marie in Alban Bergs Wozzeck. 2018 wurde sie als Titelheldin in Richard Strauss’ Salome befeuert. Daß sich der Komponist eine 16jährige Prinzessin mit Isoldenstimme
1 wünschte, wurde von Besetzungsbüro, Dirigent, Publikum und Presse ebenso ignoriert wie genaues Hinhören. Ja, Markus Hinterhäuser zeigte sich in einem Interview sogar erfreut darüber, daß er es war, der Grigorian die Rolle der Salome anbot. Der Opernfreund hört’s, und wendet sich mit Grausen. Denn heute, fünf Jahre später, klingt Asmik Grigorian in der Partie der Lady Macbeth stimmlich ebenso überfordert wie ihre um 10 Jahre ältere, österreichisch-russische Kollegin.
Veranlaßte Grigorians stimmliche Disposition Philippe Jordan, in vielen Passagen schneller voranzugehen als es Verdis Partitur und die ab Macbeth vom Komponisten vorgegebenen Metronomangaben vorsehen? Denn die erste Cavatina der Lady Macbeth — Vieni t’affretta
— ist mit Andantino, 6/8-Takt, gleichzeitig allerdings mit ♪= 72 überschrieben. Jordan dirigierte schneller (etwa mit ♪= 82) — und, nicht zum ersten Mal an diesem noch jungen Abend, zu laut. (Die handschriftliche Pariser Dirgentenpartitur aus 1865 legt für das Orchester fortgesetztes piano fest, selbst in den pochenden, staccato notierten Akkorden.)
Das gewählte Tempo betreffend befindet sich Jordan in guter Gesellschaft mit Berthold Goldschmidt (1947) und Victor de Sabata (1952). Allerdings standen letzteren beiden mit Margherita Grandi und Maria Callas Stimmen doppelt so großen Kalibers zur Verfügung, als Asmik Grigorian es bieten kann.
Jordans raschere Tempi legen das Dilemma bloß: Einerseits helfen sie der Sängerin, rascher über schwierigere Stellen » drüberzukommen «; andererseits mangelt es dadurch der gesanglichen Exekution an Genauigkeit: Viele als Sechzehntel und Zweiunddreißigstel notierte Passagen klingen verschliffen; Triller, zum Beispiel bei io ti daró valore
werden nicht gesungen. Der Wechsel vom (eigentlich schon Unterstützung der tiefen Stimmfamilie erfordernden) Bereich knapp oberhalb des passaggio zur reinen Bruststimme (selbst für ein definiertes, tiefes Sopran-› h ‹) funktioniert nicht. Die Tongebung war viel zu offen, Verzierungen (z.B. bei e retrocede
im einleitenden Rezitativ) klangen schwerfällig und wurden mit aufgerissenem Mund absolviert, jeder Ton mit einer anderen Mundstellung.
Vieni t’affretta
klang bei Grigorian denn eher nach vi-aaa-ni taffr-aaa-ta
, mit crescendierten Silben, offen gesungen und » nachgeschoben «. Aus accendere
wurde ac-cen-de-he-re
mit einer eingelegten Silbe; eine Unsitte, welche schon seit Jahrzehnten unausrottbar zu sein scheint, obwohl Sänger wie Thomas Quasthoff in ihren Meisterklassen immer wieder auf diesen Umstand aufmerksam machen.
Für die Cabaletta Or tutti sorgete
notierte Verdi Allegro und ♩= 104, im Finale fordert er zusätzlich fortissimo. Grigorian — sie sang übrigens nur eine Strophe — gebricht es dafür an der stimmlichen Unterfütterung: Die einstmals lyrische Sopran-Stimme vermag jene Kraft, welche für diese Ausbrüche notwendig ist, nicht zu entfesseln. Das ist per se nichts Schlimmes, macht aber deutlich, daß die Lady Macbeth außerhalb von Grigorians stimmlichen Möglichkeiten liegt. Dabei hat der Abend eben erst begonnen, die Bankettszene sowie die — gesangstechnisch noch anspruchsvolleren — Nummern La luce langue
und die Schlafwandelzene stehen noch bevor … Dies herunterzuspielen zeigt die auch von Brigitte Fassbaender schon öfter kritisierte Ahnungslosigkeit und Ignoranz der Intendanten ebenso wie die Tragik der überredeten Sänger, welche die Natur mit vorzeitigem stimmlichen Verfall bestraft.
Asmik Grigorian eignet allerdings ein Vorzug, der im heutigen Opernbetrieb nicht nur unerläßlich zu sein scheint, sondern geradezu gefordert (und von Publikum wie Presse gleichermaßen akklamiert) wird: Sie weiß die von den Spielvogten ihr zugemuteten schauspielerischen Anforderungen auf beeindruckende Weise umzusetzen. Ob Romeo Castellucci, Anthony Minghella (bzw. Carolyn Jane Choa), Jean-Pierre Ponnelle, Dmitri Tscherniakov oder eben Krzyzstof Warlikowski: Immer erfüllt Grigorian ihre Partie pantomimisch hervorragend.
IX.
Immer, wenn die Rede von der Partie der Lady Macbeth geht, zitieren Apologeten überforderter Stimmen Verdis Brief an Salvatore Cammarano vom 23. November 1848. In diesem lehnt der Komponist die Sopranistin Eugenia Tadolini als Lady Macbeth ab (Sie wird, ein Star ihrer Zeit, dennoch besetzt werden): […] Die Tadolini hat viel zu große Qualitäten, um diese Partie zu machen! […] Die Tadolini singt mit Vollkommenheit; aber ich möchte, daß die Lady nicht singt. Die Tadolini hat eine schöne und attraktive Erscheinung; und ich möchte, daß Lady Macbeth häßlich und böse ist. Die Tadolini hat eine wundervolle Stimme, klar, biegsam, stark; aber ich möchte, daß Lady Macbeth eine harsche, erstickte und hohle Stimme hat. Die Stimme der Tadolini hat etwas Engelhaftes, die Stimme der Lady sollte etwas Teuflisches haben. […] Denkt daran, daß die Oper zwei Hauptnummern hat: das Duett zwischen der Lady und ihrem Mann und die Schlafwandelszene. Wenn diese Stücke nicht gelingen, ist die Oper verloren; und diese Stücke dürfen auf keinen Fall gesungen werden; man muß sie mit einer recht hohlen und verschleierten Stimme darstellen und deklamieren: ohne das kann es keine Wirkung geben.
Um diesen Brief besser zu verstehen, hilft ein Blick auf Eugenia Tadolinis Biographie: Eugenia Tadolini (1808 – 1872) debutierte mit 19 Jahren und machte sich als Interpretin von Werken Rossinis und Donizettis einen Namen, ehe sie auch Alzira, Griselda (in I Lombardi alla prima crociata) und Elvira (in Ernani) sang. Tadolini war eine der erfolgreichsten Vertreterinnen des bel canto. Verdi ging es jedoch bei der Lady Macbeth nicht um selbstverliebte stimmtechnisch virtuose Brillanz, sondern um Wahrhaftigkeit — und darum, daß das Publikum jedes Wort versteht. Die Idee, eine Lady Macbeth müsse nicht singen bzw. nicht über das notwendige stimmtechnische Rüstzeug verfügen, ist, auch angesichts der technischen Schwierigkeiten der Partie, absurd. Die Rolle ist unter Einsatz musikdramatischer Mittel — Verdi schreibt immer wieder cupo oder sottovoce vor — zu interpretieren.
X.
Soprane früherer Generationen vermochten ohne Vokalmodifikationen in die und aus der Bruststimme zu wechseln. Ihre Stimmen — wie z.B. jene von Margherita Grandi — besaßen in der Mittellage (direkt über dem passaggio) Klarheit und Kraft. Das künstliche » Abdunkeln « durch das Absenken des Kehlkopfes ahmt lediglich die Farben und den Körper voluminöserer Stimmen nach und führt zu einem gedämpften und verwaschenen Klang. Dieser wird oft mit legato verwechselt, weil er » weicher « und angenehmer klingt als mit Klarheit und Kern gesungene Phrasen. Bei Grigorian waren bei länger zu haltenden Tönen die muskulären Verspannungen nicht nur zu hören, sondern — die Nahaufnahmen machen es möglich — auch zu sehen: Anstatt ruhig zu liegen, vibriert ihre Zunge im Mund und verändert den für den Luftdurchfluß zur Verfügung stehenden Querschnitt im Halsrachen.
XI.
Diese Beobachtungen werden freilich nichts daran ändern, daß Asmik Grigorian im Dezember 2023 in der Titelpartie von Puccinis Turandot auf der Bühne der Wiener Staatsoper stehen wird. Da sei die Kulturindustrie vor. Glaubt man umherschwirrenden Gerüchten, ist für 2025 Grigorians Debut als Isolde geplant …
Vielleicht hatte Markus Thiel mit seinem Vergleich so unrecht nicht?
Anmerkung: Dieser Beitrag entstand mit Unterstützung eines an großen Häusern weltweit engagierten Opernsängers; — ich will ihn Bob nennen. Bob half, meine Eindrücke zu ordnen. Er wies mich auf stimmtechnische Eigenheiten hin und beriet mich darin, technisch korrekte, dabei auch für Laien verständliche Formulierungen zu finden.
- Richard Strauss: » Betrachtungen und Erinnerungen «. Herausgegeben von Willi Schuh. Piper Schott, 1989, ISBN 3-492-18290-9 (Piper), S. 219 ff. ↵